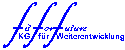
wir bringen Sie weiter.
Wir integrieren die Elemente
Individualitaet, Emotionalitaet und Logik
endloses
Band

Philosophik
physistisch philosophieren
Die anderen Domaenen:
AxioTentaO
Physistik
Sensualistik
Die Netzknoten von FitForFuture:
Zentralknoten
Wir über uns
Seminare
Konzepte
Themen
Theorie
Fundgrube
.
Wir sind
interessiert
an Ihren Fragen,
Kommentaren
und Anregungen und werden Ihnen gerne antworten
Fragen,
Kommentare und Anregungen
© 1990-2012
Rolf Reinhold
Created at 10 Mar
2007
es ist jedesmal Ihre eigene Entscheidung, ... ausnahmslos!"
Unternehmenszweck der Fitforfuture KG ist "Entwicklung, Verbreitung und Umsetzung zukunftstraechtiger Konzepte"
Philosophik
(in statu nascendi) von Rolf Reinhold
Version 4.6 vom 12.10.2011
... soll sein "Kunde ('forschen' und 'vermitteln') vom 'philosophieren' unter den Rahmenbedingungen 'EigentlichePhilosophie' und 'Physistik', also '(physistisch) sensoristische Philosophierkunde'.
Sie
basiert auf der Sicht, dass Menschen 'philosophieren', weil sie auf diese
Weise
- 'Annahmen erzeugen, mittels derer Annahmen zum handeln erzeugt werden' koennen,
- die sich notwendigerweise auf 'Mensch und Umwelt' ('MEINEWELT' je Mensch) beziehen,
- genau hinsehen auf jegliches 'entstehen der Dinge und Lebewesen',
- akribisch 'hinterfragen, was Menschen behauptet haben',
- die Grenzen des 'kapierbar' ausloten.
Der
physistische Ansatz bedingt Diskurs ueber je 'MEINEWELT' (siehe auch J.v.Uexkuell) als notwendige Voraussetzung
fuer Korrektur und Ergaenzung eigener Sichten'.
Da dieser Ansatz
alle
'mythischen' Termini und Denkfiguren durch 'hinterfragen ihrer Sensorierbarkeit' ausschlieszt, ergibt sich daraus
ein Bedarf, alle bisherigen 'philosophischen Sichten' auf 'mythenfreie' Aussagen zu ueberpruefen
und alle Uebersetzungen philosophischer Texte mit relevanten Inhalten dementsprechend zu
ueberarbeiten. Insbesondere die Texte der griechischen Antike sind aus dieser Sicht in
unzulaessig entstellender Weise anachronistisch mit den 'Denkfiguren' der christlichen Kultur besetzt worden.
Die oben gelieferte Operationalisierung von 'physistisch philosophieren',
'Annahmen zweiter Ordnung erzeugen, mittels derer Annahmen zum handeln erzeugt werden'
ist ein erstes Beispiel dafuer, dass alle verwendeten Termini dieser
'Art zu philosophieren' 'mit anderen Augen betrachtet' werden muessen,
wenn dieser Ansatz konsequent durchgehalten wird.
Die
Tatsache, dass diese 'Annahmen erster und zweiter Ordnung (Annahmen
ueber Annahmen)' das 'WeltBild' und die 'WeltSicht' von Menschen
praegen, macht 'philosophieren' zu einem 'forschen, welche
WeltSichten und WeltBilder andere haben und welche ich'.
Wenn
ich 'Sicht' operationalisiere als 'Art und Weise, etwas zu betrachten',
bezieht der Terminus 'WeltSICHT' sich auf 'jeweilige individuelle Art
und Weise, das zu betrachten und zu bewerten, was mich umgibt'.
Das entspricht dem von Platon ueberlieferten (zweiten Halb-)Satz des
Protagoras "Die Dinge sind fuer dich, wie sie dir erscheinen und fuer
mich, wie sie mir erscheinen".
Wenn
ich 'WeltBILD' operationalisiere als 'das BILD, das ich mir von dem
mache, was mich umgibt', beschraenkt sich dieses 'WeltBILD' auf 'das,
was ich sinnlich erfassen (perzipieren) kann', gewissermaszen 'wovon
ich ausgehe, wenn ich handeln moechte', also 'meine Annahmen ueber die
und meinen Bezug zu Funktionen von Dingen und Lebewesen'.
Somit befasst sich aus dieser Sicht 'physistisch
philosophieren' mit 'weltbildforschen' und 'weltsichtforschen' und kann
daraus sowohl 'neue Annahmen ueber das Herstellen von Annahmen', als
auch auf dieser Basis wiederum 'neue Annahmen zum Handeln'
erzeugen. Frueheren Ansaetzen
unterstelle ich, bis
auf sehr wenige Ausnahmen,
allermeist 'ungepruefte Uebernahme frueherer Schlussfolgerungen', insbesondere derer von Platon und Aristoteles. Der Vorteil der hier praesentierten und weioter zu entwickelnden Annahmen besteht
darin, dass hier 'JEDE BASIS jederzeit jedem
Menschen zur erneuten Ueberpruefung zur Verfuegung steht'. Jaspers:
"Das Wagnis des scheinbar Neuen, in Wirklichkeit uralten, verschiebt
allerdings auch gewohnte Akzente. Was kaum beachtet war, gewinnt Raum;
was im Vordergrund stand, geraet in den Hintergrund". Das bezeichne ich
als "thematisieren": ein neuer Aspekt wird mit vorherigen Ueberlegungen
verglichen, womit ueberkommene Standpunkte aufgeloest und neue Perspektiven eroeffnet werden koennen.
Reduktionen der antiken philosophischen Aktivitaeten
Nachdem allererste philosophische Aktivitaeten der "ersten eurpaeischen Aufklaerung"(RR 2010) 'alle Dogmata hinterfragten', entstanden spaeter immer mehr Einschraenkungen jeglichen 'hinterfragen'.
Jenes 'hinterfragen' begann mit den 'traditionellen Setzungen
der eigenen Kultur', ueber 'entstehen der Dinge und Lebewesen' bis zu
'animalischen und menschlichen Funktionen'. Aus den hartnaeckigen dogmatischen Gegenbewegungen
entstanden spaeter immer mehr 'Restaurationen alter Denkfiguren', bis
hin zu der voelligen Unterdrueckung jeglichen 'hinterfragen' durch
christliche Dogmatiker.
Das 'philosophische Schisma'
...
als 'Trennung von forschen und philosophieren' hatte seinen Ausgangspunkt vermutlich
aufgrund der Aktivitaeten und Aeuszerungen der Nachfolger von Aristoteles. Physisch
vollzogen wurde es durch die Auslagerung der peripatetischen Bibliothek
und damit auch der forscherischen Aktivitaeten durch die Erben des
Theophrastos von Athen in die Bibliothek von Alexandria, die spaeter voellig verbrannte.
Die 'philosophische Blasphemie'
...
entstand aus der Gegenwehr gegen kirchliche Bevormundung in der (zweiten europaeischen) Aufklaerung. Dabei wurde
jedoch lediglich das Dogma der Kirche durch das Dogma der
Gegeninstitution ""Wissenschaft"" ersetzt und wesentliche (religioes) dogmatische
Sichtweisen beibehalten. Diese Institution ""Wissenschaft"" wurde von
Menschen gebildet, deren Vorfahren jahrhundertelang von klerikalen
Dogmatikern indoktriniert worden waren. So wurden also in der
Folge unreflektiert
die
""Wahrheits""ansprueche des Klerus uebernommen (siehe den Konflikt Galileis), aus denen der Anspruch
zu ""wissen"" resultiert. Sobald
wir diesen Anspruch, "Wahrheit gepachtet zu haben" fallen lassen,
koennen "glauben" und "forschen" eintraechtig nebeneinander
praktiziert werden.
Ob
ein Mensch "apeiron", "to on", "Tao" oder
"Gott" als "das, was sich meinem 'denken (hier als sensoristisches
"... 'denken' als simulieren von Organlagen")' entzieht" setzt oder
empfindet, bleibt das Ergebnis gleichermaszen "Grenze dessen, was fuer
mich kapierbar ist".
Diese 'Grenzen menschlicher Denkfaehigkeit' festzusetzen war den
griechischen Denkern wichtig gewesen und auch weitestgehend von ihnen
vollzogen worden.
Das 'philosophische Dilemma'
... entstand jedoch immer von neuem aus "glaeubig uebernehmen", bei dem die 'Adepten' die vorherigen Ueberlegungen auf "DIE GROSZEN Philosophen" zurueckfuehrten, denen gegenueber jegliches 'zweifeln' unangebracht war.
So fehlte fast allen Philosophen einfach die Basis des "genau hinsehen (skep[t]esthai! = skepsis = beobachten, untersuchen [das deutsche Adjektiv 'skeptisch' ist nicht mit 'zweifelnd' zu verwechseln, da es im Sinne von 'abwartend, beobachtend' verwendet wird]... sowohl von Aristoteles als auch Platon anempfohlen; Kant: "... selber denken!")". Sie 'kaprizierten' sich auf Einzelaspekte, die sie der uebernommenen Basis hinzufuegten. Die christliche Denkweise tat ein uebriges dazu, indem sie von "Notwendigkeit der Glaeubigkeit" ausging und das Absolutum ""Wahrheit"" zum "Ziel aller Philosophie" erklaerte.
Rahmenbedingungen fuer 'physistisch philosophieren'
Die Rahmenbedingungen fuer 'philosophieren' waren nach dem 'apeiron'
des Anaximandros, dem 'to on' des Parmenaides, dem 'panta rhei'
des Herakleitos und dem 'atomos' des Demokritos unhintergehbar
festgelegt.
- 'apeiron' als 'das, was alles umfasst (Gigon: Gesamtheit der Materie)', sozusagen "der ('letzte') Raum (Zenon), in dem alles 'existierende' enthalten ist, der selber in nichts anderem enthalten ist" bzw. "das EINE, das kein zweites hat (Platon, 'to on' :=: 'to pan')" entspricht in seinem 'fuer Menschen unerreichbar, unzugänglich' unserem heutigen 'unendlich'und 'ewig'.
- 'to on' beziehungsweise 'to eon' ist das 'Partizip Praesens' von 'einai (sein)' und entspricht somit in seinem 'seiEnD' einem 'gleichbleibend' (und damit dem 'apeiron', siehe Melissos), das im Sinne von 'verlaesslich' zwar von Menschen angestrebt und 'hineininterpretiert', aber nie erreicht werden kann. Diese Sicht ergibt sich aus den Aussagen des 'Lehrgedichts', wenn unterstellt wird, dass Parmenaides ein Wortspiel betrieben hat mit den beiden Deutungsmoeglichkeiten des 'to on', einmal als 'gleichbleibend', wenn es KEINEM Gegenstand ('apeiron', 'ewig', 'unendlich' sind weder Gegenstaende noch Eigenschaften; KEIN Gegenstand KANN 'eigenschaftslos' sein) eine Eigenschaft zuordnet und zum anderen 'vorhanden, anwesend' ('existierend'), wenn es Gegenstaenden zugeordnet ist.
- 'panta rhei' mag als 'Charakterisierung permanenter Veraenderung' und bezogen auf 'alles sinnlich erfassbare' als Zitat dem Herakleitos nicht zuzuordnen sein, als sinngemaesze Zusammenfassung seiner Aussagen duerfte es jedoch zutreffend sein. Es kontrastiert und karikiert die Anstrengungen der Menschen, in ihrem 'bemuehen um Sicherheit und Verlaesslichkeit' das 'flieszen' aufhalten und zum Stillstand bringen zu wollen.
- 'atomos' charakterisiert 'Unzugaenglichkeit des Kleinsten', heute nur noch mit dem theoretischen Postulat 'Boson' zu verdeutlichen.
- 'bios' als "Raetsel des 'lebendig sein'. kaeme als weiteres hinzu. Direkte Aueszerungen antiker Philosophen zu diesem Thema sind mir in meiner bisherigen Lektuere jedoch noch nicht begegnet, waeren moeglicherweise aber schon bei den 'Pythagoraeern' (z. B. Alkmaion?) zu finden. Indirekt thematisiert wird es jedoch auch schon durch alle Ueberlegungen zu 'perzipieren (physistisch: 'sensorieren')', eventuell mit dem, was als 'nous' bezeichnet und (vermutlich anachronistisch) als ""Geist"" uebersetzt wurde.
Nach
dieser Festlegung des Rahmens des 'kapierbar' koppelte sich
'erforschen von Gesetzmaeszigkeiten' unter dem Einfluss der Texte von Platon und Aristoteles immer mehr von den traditionellen
Aktivitaeten der Philosophen ab. In der "hellenistischen"
Phase verlagerte sich 'forschen' fast gaenzlich von Athen nach
Alexandria, da die Erben des Nachfolgers von Aristoteles (Theophrastos) die gesamte Bibliothek nach dorthin verlagert hatten.
Philosophieren als 'Kulturkritik'
Wenn
der Beginn des 'philosophieren' bei Anaximandros als "abkehren von
'zuhoeren und uebernehmen'!" und "hinwenden zu 'hinsehen und selber
denken'!" betrachtet wird, ist dies der Ausgangspunkt 'Kritik
(fragendes, also auch 'infragestellendes' Betrachten) der bestehenden
eigenen Kultur'. Deutlich wird das aus Fragmenten von z. B.
- Alkidamas: "Die Philosophie ist ein Angriffswerk gegen Gesetz und Brauch" (Nestle, Aristoteles, Rhet. III 3, 1406 b 11)
- Hippias: "...; die Sitte (nomos) aber, die den Menschen tyrannisiert, setzt mit Gewalt vieles Natur(physis)widrige durch." (Nestle, Fr. C 1 bei Platon, Protag. 337 C Ds.)
- Diogenes: "Ich praege die gaengigen Werte um" (Nestle, D 6, 20)
- Krates: "Man muss solange Philosophie treiben, bis die Feldherren als Eselstreiber erscheinen" (Nestle, D 6, 92)
- Aristippos:
"Der Kundige (sophos, der 'Kundige'; RR) ist frei von Neid, Leidenschaft und Aberglauben: denn alles
das ist Wirkung falscher (ich wuerde hier 'falscher Vorstellungen' durch 'irriger Vorstellungen'
oder sogar durch das noch neutralere 'von Vorstellungen' ersetzen; RR)
Vorstellungen. Dagegen kann er in Trauer und
Angst kommen: denn das beruht auf physischen Vorgaengen." (Nestle, D 2,
91)
Bereits
Anaximandros kann so interpretiert werden, dass er den ersten Ansatz
zur 'Ueberwindung' des Mythos, naemlich der herkoemmlichen 'menschengestaltigen Ursachen des
Geschehens' ueberlegt hatte. Sein 'hinsehen' bescherte uns zumindest
mit der 'Denkfigur' "apeiron" eine Grenze des 'fuer Menschen
erreichbar'. Dieser Negation moechte ich das Wort 'empeiron' gegenueberstellen, das den antiken Griechen offensichtlich als 'fuer Menschen erreichbar' galt.
Wenn Parmenaides dahingehend interpretiert wird,
dass er mit seine 'to (e)on' dem Gedanken 'apeiron' folgte, brachte er
uns damit den weitergehenden Nutzen, jegliches 'gleichbleibend' hinter
eben diese Grenze des 'fuer Menschen erreichbar(A-peiron im Gegensatz zu EM-peiron)' zu verbannen. Das
widerspricht deutlich dem Beduerfnis der Menschen nach der 'in
der Vorstellung von "Gewissheit" liegenden Sicherheit', die ausschlieszlich in den
dogmatischen Setzungen der Kulturen liegen kann. Es ist auch heute noch
so, dass Menschen auf jegliches 'infragestellen' der 'aus sich selbst
heraus verstaendlichen Gewissheiten',
den "Selbstverstaendlichkeiten" ihrer "LEBENSWELT" (siehe Husserl: das, was Menschen nicht infragestellen)
ihres Kulturkreises' mit heftiger Abwehr reagieren.
Westlicher Kulturkreis: Gepraegt durch Platon, Aristoteles und Christentum?
Die in einem Kulturkreis uebliche Wortwahl sagt alles ueber das vorherrschende Weltbild aus. Denn hinter der Wortwahl stehen GRUNDlegende Ueberlegungen.
Verdienst der weitestgehend ignorierten griechischer Denker
... sehe ich darin, die Grenzen von 'kapieren koennen' ins Auge gefasst zu haben.
- unbegrenzt (Anaximandros; Zenon: 'der letzte Raum')
- gleichbleibend (Parmenaides)
- jetzt (Parmenaides)
- vorhanden (Parmenaides)
- leben mit den Unterscheidungen
- beobachten
- merken
- erinnern
- denken
- werten
- sprechen
- benennen
- und ... negieren
Selbst dann, wenn wir davon ausgehen, dass Parmenaides
tatsaechlich gegen Herakleitos und mit Pythagoras kongruent formuliert
hatte, stehen dennoch die Aussagen von sowohl Zenon, als auch Melissos
und Anaxagoras und nicht zuletzt Protagoras und Gorgias zumindest
teilweise im Kontrast dazu.
So betrachtet etwa Theodor Gomperz die Darlegungen von Zenon als
"Widerlegung der Lehre des Parmenaides"(sinngemaesz). Er kam jedoch
ueberhaupt nicht auf die Idee, dass das Gegenteil der Fall sein
koennte.
Meine Arbeit zu Parmenaides steht zwar noch ziemlich am Anfang, laesst
jedoch jetzt schon die Aussage als 'moeglicherweise zutreffend'
erscheinen, dass er keineswegs ""DAS Sein"" in den Mittelpunkt stellte
und "jede Bewegung negierte".
Denn es geht keineswegs 'zwingend notwendig' aus den Fragmenten hervor,
dass er 'scheinen' ueberhapt nur kritisierte, geschweige denn
'Realitaet (ta onta)' ignorierte oder gar negierte. Abgesehen davon,
dass ihm das Schciksal des Midas beschert gewesen waere, wenn er
Nahrungsmittel als Illusion betrachtet und folglich verweigert haette,
wird er wohl auch kaum die 'Bewegungshandlungen der
Nahrungsmittelaufnahme' unterlassen haben.
Eine 'konsequent skeptische' Interpretation ist mir bisher noch nicht
bekannt geworden (fuer Hinweise waere ich dankbar), obwohl er von
manchen Autoren durchaus als 'frueher Skeptiker' betrachtet wird.
Es wurde offensichtlich bisher ignoriert, dass 'aletheia' keineswegs
der christlichen Denkfigur ""Wahrheit"" entsprochen haben konnte,
sondern sehr viel eher einem 'was mir vorhanden zu sein (er)scheint'.
Hinweise darauf, wie etwa der von Heidegger, 'aletheia' als
'Unverborgenheit' zu uebersetzen, fuehrten bisher zu keiner
grundsaetzlichen Neuinterpretation.
Die moeglichen Kombinationen der verwendeten Termini lassen naemlich
durchaus zu, zum einen 'sich im Forschen auf das Vorhandene zu
beschraenken' und zum anderen auch dessen 'Vermischung mit dem
nichtvorhandenen' als Moeglichkeit zu verwerfen.
Nestle plaediert in seinem Vorwort zu "Griechische
Weltanschauung in ihrer Bedeutung fuer die Gegenwart"1946 dafuer, "aus
dem Griechentum ... (fuer uns) ... Welt und Leben wieder einmal
unbefangen, ohne die christliche Beleuchtung, rein menschlich" zu
betrachten. "Und taeten wir nicht besser, an die Stelle einer
ueberlebten christlichen Mythologie die uneingeschraenkte Erforschung
der Wirklichkeit in Natur und Geschichte und an Stelle einer
ueberspannten, im Grunde weltfluechtigen Ethik eine solche natuerlicher
Sittlichkeit und zuversichtlicher Weltoffenheit zu setzen, kurz, eine
unehrliche Christlichkeit mit einer ehrlichen Menschlichkeit zu
vertauschen?".
Wer tatsaechlich ernsthaft antike Texte uebertragen moechte, sollte es
unterlassen koennen, christliche Denkfigueren in antike Zusammenhaenge
hineinzulegen.
Besonderheiten griechischer Weltsicht
Es
ist zu vermuten, dass die nuechtern sachliche Betrachtungsweise gerade
deswegen in Griechenland entstehen konnte, weil das
Kommunikationsverhalten hier andere Grundlagen hat als im uebrigen
Europa. So unterstelle ich tastend: Die alten Griechen haben 'Aspekte
aus eigenem Blickwinkel aufgezeigt' und in ihren Diskursen 'Aspekte
anderer gewuerdigt und verglichen'.
Den
Kontrast dazu bildet
'argumentieren' bzw. 'beweisfuehren', das vermutlich erst mit der von
Anhaengern und Nachfolgern des
pythagoraeisch dogmatischen Ansatzes beginnt und in der im stoischen
Ansatz geuebten Praxis des 'diffamieren' seinen vorlaeufigen
Hoehepunkt findet.
Generelles
Kulturelle Hindernisse
Christlich
gepraegte Interpreten haben den 'mythos', von dem sich die alten
Griechen offensichtlich entfernen wollten, immer wieder mehr oder
minder mit 'Aberglauben' gleichgesetzt.
Was waere aber, wenn diese
'ersten Denker des Abendlandes' mit 'mythos' 'alles das, was ich nicht
sensorieren kann' gleichgesetzt haetten?
Was waere, wenn sie bemerkt
haetten, dass 'mythos' 'Denkfiguren' bereitstellte, in die jeder 'alles
hineinlegen kann, was ich moechte (Bateson: 'Erklaerungsprinzip')' und
somit jegliches 'einigen' unmoeglich wird?
DASS es in menschlichen Gemeinschaften 'EinigungsBEDARF', gab und gibt, daran werden sie nicht vorbeigesehen haben.
Das
'a-peiron' als 'alles unerforschliche, unzugaengliche', das einem
'em-peiron', einer 'erforschbaren (sensorierbaren) gegenstaendlichen
Welt' gegenuebergestellt wuerde, haette, falls es von Xenophanes
aufgegriffen worden war, eben jenes 'eine allumfassende,
gleichbleibende' durchaus als 'theos' bezeichnen lassen. Oder eben auch
als 'to on', als 'das, was gleichbleibt' oder als 'to pan' (Platon) als 'das, was alles enthaelt'. Oder auch als 'Tao'.
Sprachliche Hindernisse
Bei
genauerem 'hinsehen' finde ich unsere Sprache 'durchsetzt mit
Hindernissen' gegenueber 'beschreiben' von 'sensorierbaren
Erscheinungen', von "Fakten", woertlich genommen als 'das, was ich
erlebe, wenn ich handele'. Allein schon dieser Satz kostete
mich einiges 'ueberlegen', um Worte zu finden, die 'lediglich
sensorierbares beschreiben'.
Als erstes '(DAS!) Hindernis' faellt mir
immer wieder 'DER Hang zur (zu DER!) SubstantivierUNG' auf.
Was machen wir da eigentlich, wenn wir 'Taetigkeitsworte' und 'Eigenschaftsworte' in ein Substantiv verwandeln?
Welche Folgen hat das fuer unsere 'Weltsicht'?
Enkulturation als Hindernis
'Enkulturation' bedeutet 'hineinwachsen in die kulturspezifischen Vorstellungen der Vorfahren'. In der Regel uebernimmt ein Mensch damit 'grundlegende Auffassungen'. Diese 'grundlegenden Auffassungen' bezeichnet Husserl als "Lebenswelt" und operationalisiert sie (sinngemaesz) als "das, was ein Mensch nicht infrage stellt".
Dogmatischer Ballast
... aufgezeigt am Beispiel der 'Uebersetzungen' des Textes von Parmenaides.
Der 'Kernbegriff' des Lehrgedichts ist das Partizip Praesens des Wortes 'sein' (einai) also 'seiend' ([to] on). Dieses wird auch als 'Hilfswort' (Hilfsverb, Kopula) bezeichnet, da es eigentlich nur zusammen mit einem Eigenschaftwort verwendet werden kann. Die Gleichsetzung 'ist ein ...' kann 'adjektiviert' oder 'operationalisiert' werden: "Sokrates ist ein Mensch" als "Sokrates ist menschlich" oder "Sokrates lebte".
Entscheidend fuer meine Interpretation ist nun, dass Parmenaides dieses Hilfswort weitgehend OHNE Beifuegung von Eigenschaftworten verwendet. daraus ergibt sich zwingend die Frage "WAS kann 'ohne Eigenschaft' sein?".
'Eigenschaft' moechte ich operationalisieren als "das, 'was der Gegenstand mir bedeutet' und 'wie der Gegenstand aus meiner Sicht beschaffen ist'. Dem folgend haette jeder 'fuer mich vorhandene Gegenstand' zwangslaeufig 'Eigenschaften'. Einen 'Gegenstand ohne Eigenschaften' kann es demnach nicht geben.
Folglich sind einige Uebersetzer auch so konsequent gewesen, dem von Parmenaides mit 'seiend' Bezeichneten die NICHTeigenschaft "ewig" zuzuordnen. Und dieser Grundgedanke ist bereits in dem 'apeiron' des Anaximandros enthalten, wurde also von Parmenaides lediglich aufgegriffen, soweit wir davon ausgehen, dass der ihm bekannt war. Sein 'Schueler' Melissos weist auch ausdruecklich auf diese Gleichbedeutung hin.
Begriffliche Hindernisse
Homunculi
Wann zuerst ein Terminus eingefuehrt wurde, der dem heutigen
"Geist" entspricht, ist mir noch nicht klar. Vermutlich war es,
moeglicherweise bei Platon, der Terminus 'nous' als 'substantivierte
Aktivitaet', der die spaeteren Christen veranlasste, ihre Denkfigur
"Geist" hineinzuinterpretieren.
Ebenso duerfte es sich mit dem Terminus 'psyche' = 'Lebenshauch'
verhalten, in den die christliche Denkfigur "Seele" hineininterpretiert
wurde.
Alle 'Erklaerungsmodelle', wie es auch "Gott (hat die Welt erschaffen),
"Seele (ist Quell des Lebens)" und "Geist (ist Quell der
Problemloesefaehigkeit)" sind, haben ihren Nutzen darin, mit quaelenden
Gedankengaengen abzuschlieszen.
Wenn mir ein Philosoph sagt, fuer ihn gebe es einen 'Homunculus' in
jedem Menschen, akzeptiere ich das als seine Loesung fuer ein 'Ende der
Gruebeleien darueber'.
Wenn 'Homunculi' wie auch und insbesondere "DIE Vernunft", "DER Wille",
"DER Verstand", "DAS Bewusstsein" (etc.) allerdings zur 'Argumentation'
angefuehrt werden, streikt bei mir etwas.
Auch ich kann anhand der Ergebnisse der neurophysiologischen Forschung
keineswegs darauf schlieszen, WIE die internen 'Aktivitaeten' bei
Lebewesen funktionieren. Zwar lassen sich moeglicherweise 'Prozesse'
abbilden, aber 'Prozesse' und 'Aktivitaeten' sind nicht aufeinander
zurueckzufuehren.
Mit aehnlicher Akzentuierung ist das bereits David Hume wie auch Ernst
Mach und seinen Schuelern (z. B. Mauthner und Wahle) deutlich gewesen.
Folgen wir diesem Gedanken, koennen wir einfach auf
'Erklaerungsmodelle' ("Fiktionen"!) dieser Art verzichten und uns auf
die Darstellung von Zusammenhaengen wie "erhoehter Stoffwechsel in
einem bestimmten Bereich des Gehirns bei bestimmten Aktivitaeten" in
zurueckhaltender Weise beschraenken.
Sicherlich lassen sich manche Schlussfolgerungen aus der
Gehirnforschung ableiten, wie z. B. "erinnern hat moeglicherweise mit
dem Wachstum der synaptischen Verbindungen zu tun". Das koennte dazu
fuehren, dass 'lernen' zukuenftig als "abhaengig von velfaeltiger
Anregung aller Sinne" betrachtet und die 'Lernbedingungen'
dementsprechend gestaltet werden.
'physistisch sensoristisch philosophieren'
... stellt, ebenso wie 'Eigentliche Philosophie', einen Rahmen zur Verfuegung, der moeglicherweise mit unterschiedlichen Ansaetzen gefuellt werden kann. Daher habe ich meine Schlussfolgerungen von diesem Ansatz getrennt gehalten und veroeffentliche sie unter der Bezeichnung 'AxioTentaO' zur Verfuegung. Das mag als Anlass dienen, 'philosophieren' nach Ansaetzen zu trennen, die ihren Blickwinkel deutlich als Hintergrund zur Beurteilung der enthaltenen Ueberlegungen darstellen.
Am Beginn des 'philosophieren'
stand die abstrakteste aller Ueberlegungen, Anaximanders "apeiron". Das koennen wir in unserer Sicht als "Unendlichkeit" oder auch "Weltall" im Sinne von 'Gesamtheit aller Materie' bezeichnen. Seine Ueberlegungen fuehrten ihn dazu, dieser gedachten Abstraktion jegliche Eigenschaften abzusprechen. Er verlieh dem "apeiron" die Attribute "ungeworden", "unvergaenglich", "unendlich", "unbeweglich". Damit grenzte er es von dem ab, "was uns zugaenglich ist".
(wird fortgesetzt ... z.B. wenn sie uns
per eMail nach näheren Einzelheiten fragen, wir schicken Ihnen die
Fortsetzung gern zu. Entweder als newsletter oder auf Ihre direkte Anfrage
auch als direkte Antwort per eMail)
eMail
(zurueck
zum Seitenanfang)
©1990-2012 Rolf
Reinhold
Last updated at 15 Jul 2012

form
follows
function